Das gesprochene Wort gehört zu den wichtigsten Mitteln der zwischenmenschlichen Kommunikation. Damit auch taube oder gehörlose Menschen uneingeschränkt am sozialen Leben teilhaben können, gibt es Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher. Sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen Hören, Sprechen und Sehen. Wir sprechen mit der Gebärdensprachdolmetscherin Magdalena Meisen.
Frau Meisen, kann man mit Gebärdensprache Dinge sagen, die man mit "klassischen" Worten nicht sagen kann? Oder umgekehrt?
Nein, ich würde Gebärden- und Lautsprache als gleichwertig beurteilen. Gebärdensprache ist eine vollwertige Sprache mit eigener Syntax, eigenen grammatischen Strukturen und auch einem eigenem Lexikon. Eine Besonderheit sind allerdings Eigennamen. In der Gehörlosen-Community ist es üblich, diese zu umschreiben – ein bekanntes Beispiel dürfte Ihnen Kevin Costner geben: „Der mit dem Wolf tanzt“.

Ansonsten lassen sich Eigennamen oder auch Begriffe, die nicht im Wortschatz der Gebärdensprache vorkommen, über das Fingeralphabet ausbuchstabieren. Das hat allerdings seine Tücken: Sie können sich vorstellen, dass es den Prozess des Simultandolmetschens erheblich verlangsamt. Und es verlangt dem Dolmetschenden einen leistungsstarken „Pufferspeicher“ im Gehirn ab, denn er muss ja während des Dolmetschens trotzdem weiter den Gesprächsinhalt aufnehmen.
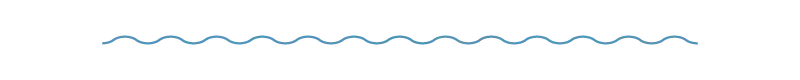
Welche Grenzen gibt es beim Gebärdendolmetschen und wie kann man sie überwinden?
Generell herausfordernd ist kulturelles Dolmetschen, beispielsweise das Übersetzen von Poesie, von Witzen oder Wortspielen und geflügelten Worten. Im englischsprachigen Raum gibt es beispielsweise den Ausdruck „It’s raining cats and dogs“ für Starkregen. So etwas können Sie natürlich nicht wörtlich in eine andere Sprache übertragen, sonst sehen Sie in verdutzte – oder vielleicht sogar auch unangenehm berührte - Gesichter.
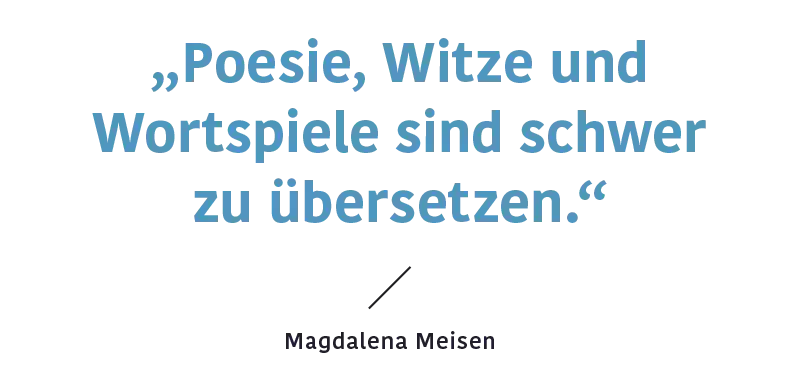
Auch der Umgang mit Emotionen ist für uns Gebärdensprachdolmetscher ein spannendes Thema: Unser Auftrag kann es durchaus sein, Emotionen mit rüberzubringen – und das geschieht logischerweise durch Mimik. Wichtig dabei ist jedoch, dass wir mit unsere Mimik nicht unsere eigenen Gefühle ausdrücken dürfen, sondern die Gefühle der Person, dessen Rede wir übersetzen. Wenn ich beispielsweise im Bundestag bei einer Debatte eine Polemik in die Gebärdensprache übersetze, dann kann es vorkommen, dass ich spöttisch schaue – was aber nicht mein privates Werturteil ist, sondern die Übertragung des Spotts des Vortragenden.
Man kommuniziert sichtbar, macht sich selbst dabei aber unsichtbar. Das geht übrigens so weit, dass wir beim Dolmetschen unauffällige Kleidung, zumeist in Schwarz, tragen und auch auf Schmuck oder sonstige Accessoires verzichten.
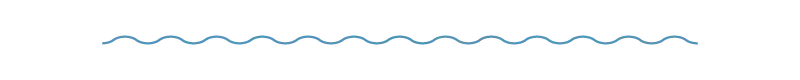
Wie wird man Gebärdensprachdolmetscher und wie lange dauert es, bis man sich wirklich parkettsicher fühlt?
Das Gebärdensprachdolmetschen ist ein klassischer Studiengang, der hierzulande von einer Handvoll Unis angeboten wird. Der Numerus Clausus ist relativ anspruchsvoll – und wer zugelassen werden möchte, der sollte die Gebärdensprache zumindest in Ansätzen bereits beherrschen. Ich selbst hatte das große Glück, dass ich aufgrund meiner tauben Eltern gleich „zweisprachig“ aufgewachsen bin und meinen Beruf damit quasi schon in die Wiege gelegt bekam.
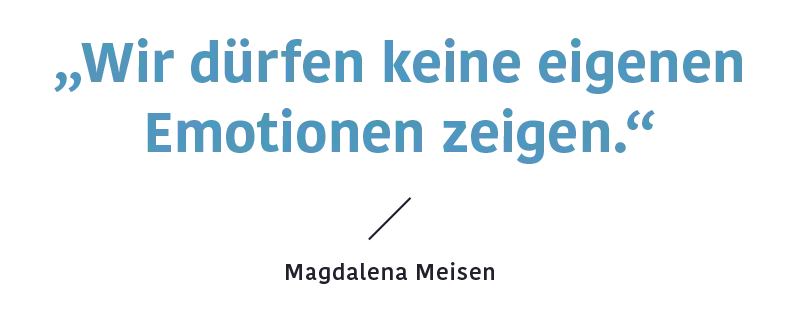
Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester, man kann aber auch noch Zusatzqualifikationen separat erwerben, zum Beispiel für Simultanübersetzen oder Dolmetschen vor Gericht. Meine Einschätzung ist, dass man nach dem erfolgreichen Studienabschluss noch mindestens zwei Jahre braucht, idealerweise mit Begleitung durch eine Mentorin oder einen Mentorin, bis man sich wirklich auf die Bühne traut. Und selbst dann gibt es immer noch Situationen, an die man sich erst einmal adaptieren muss.
Gerade eben erst habe ich beispielsweise eine junge Gebärdensprachdolmetscherin beraten, die einen tauben Mann zum Urologen begleiten musste. Herausfordernde Situationen sind aber auch Beerdigungen oder polizeiliche Befragungen. Am Ende ist es wie mit allen Berufen, man lernt auch nach jahrzehntelanger Tätigkeit immer etwas dazu.
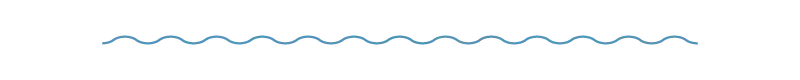
Magdalena Meisen
Magdalena Meisen ist seit 1993 vereidigte Gebärdensprachedolmetscherin. Sie arbeitet nach der Berufs- und Ehrenordnung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Gebärdensprache.
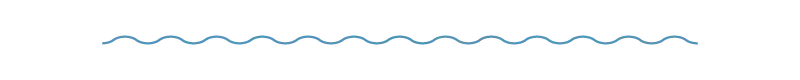
Mehr „3 Fragen an“
„Von China aus betrachtet sieht die Welt alles andere als trüb aus“ – der Satiriker Christian Y. Schmidt. Zum Gespräch
„Wir schaffen einen Prototypen für solidarische Selbsthilfe“ – der Publizist Holm Friebe. Mehr erfahren
„Ohne Schnee würden wir auskommen“ – der ehemalige Skispringer Sven Hannawald. Zum Beitrag
Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Schnittstelle“



