Herr Peper, Sie beraten Behörden, die die Digitalisierung vorantreiben wollen. Wie steht Deutschland im innereuropäischen Vergleich da?
Ich hätte gerne bessere Nachrichten für Sie, aber: Deutschland belegt im eGovernment-Benchmark 2023 der Europäischen Kommission Platz 21 von 35 – und hat sich damit im Vergleich zum Jahr 2022 leider auch keinen Deut verbessert. Da ist buchstäblich noch viel Luft nach oben.
Woran liegt das? Hapert es eher an der Technik, am Mindset oder an der Bürokratie?
Natürlich sind viele Verfahren unnötig komplex und veraltet, die zur Bearbeitung von Leistungen wie dem Kindergeld notwendig sind. Bei der technischen Ausstattung der Behörden sehe ich jedoch nicht das Hauptproblem. Beim Mindset sollte man differenzieren: Die vielzitierte deutsche Gründlichkeit in Form des Bürokratiemodells von Max Weber hat ja auch durchaus Vorteile – beispielsweise in Form von Rechtssicherheit, klaren Regeln oder konsequenter Trennung von Amt und Person.
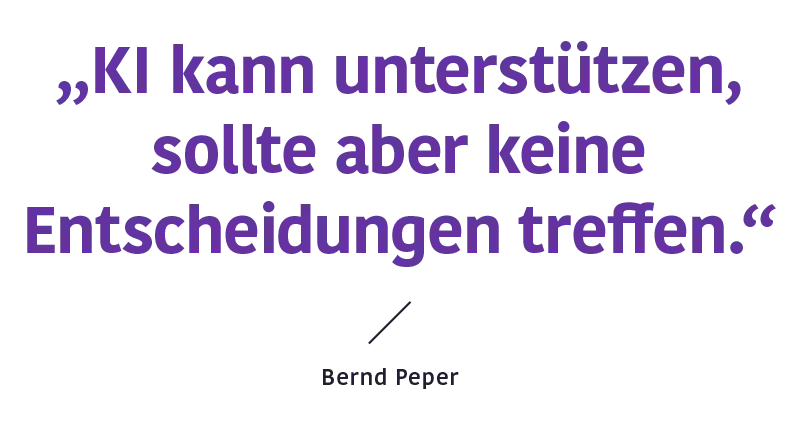 Trotzdem brauchen wir eine Modernisierung – und dabei muss man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Darum ist mir aber nicht bange, denn wir sehen, dass vor Ort in den Ämtern und Behörden inzwischen bereits an vielen Stellen eine Generation am Steuer sitzt, die die Digitalisierung mit viel Elan und Power voranbringen möchte. Wo wir insgesamt noch deutlich stärker werden müssen, ist die nutzerzentrierte Produktentwicklung – sowohl in Richtung der Bürgerinnen und Bürger als auch in Richtung derjenigen, die die Systeme in den Behörden bedienen. Hierzu müssen Strukturen geschaffen werden.
Trotzdem brauchen wir eine Modernisierung – und dabei muss man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Darum ist mir aber nicht bange, denn wir sehen, dass vor Ort in den Ämtern und Behörden inzwischen bereits an vielen Stellen eine Generation am Steuer sitzt, die die Digitalisierung mit viel Elan und Power voranbringen möchte. Wo wir insgesamt noch deutlich stärker werden müssen, ist die nutzerzentrierte Produktentwicklung – sowohl in Richtung der Bürgerinnen und Bürger als auch in Richtung derjenigen, die die Systeme in den Behörden bedienen. Hierzu müssen Strukturen geschaffen werden.
Haben wir aktuell zu viele Einzelkämpferbehörden und -ämter? Brauchen wir eine Art interdisziplinärer Großraumbüros?
Ich finde schon. Die Zukunft gehört klar crossfunktionalen Einheiten, in denen die Beteiligten intensiv zusammenarbeiten und den ganzen Prozess oder das gesamte Produkt im Blick haben anstatt ihres einzelnen Bereichs.
Experimentieren wir zu wenig? Brauchen wir – wie in der Wirtschaft – mehr Reallabore für die Verwaltung?
Es gibt solche Labore schon, denken Sie nur an die diversen GovTech-Initiativen wie GovTech-HH und deren Experimentierklausel. Aber Experimentieren allein hilft nicht immer. Oft ist es so, dass diese Initiativen zu sehr von der Kernorganisation entkoppelt arbeiten. Da entstehen zuweilen beeindruckende Showcases, die aber am Ende leider oft den Rücktransfer in die Praxis nicht schaffen. Digitalisierung ist – hart gesagt - eine multidimensionale Integrationsaufgabe. Wenn sie gelingen soll, muss sie tief in die Strukturen und Kernprozesse und auch die bestehende IT hinein orchestriert werden. Es wird nicht reichen, auf der grünen Wiese oder unter experimentellen Bedingungen eine Idee zu entwickeln, die am Ende aufgrund der vorhandenen Strukturen nicht in der Breite realisiert werden kann.
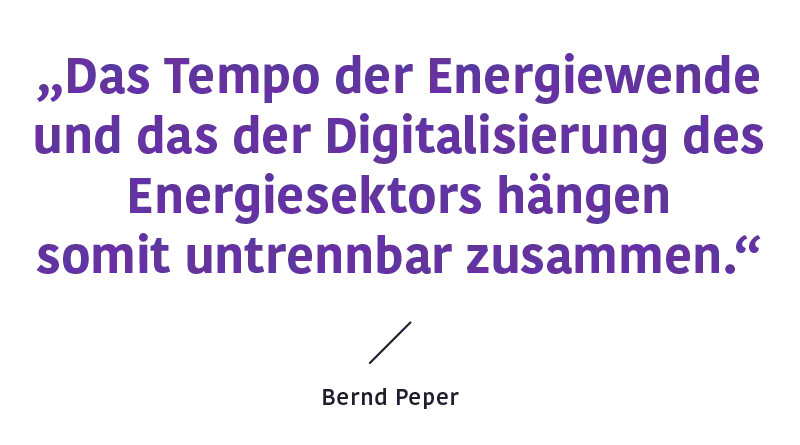
Dass Digitalisierung in der Verwaltung grundsätzlich funktionieren kann, haben die Finanzbehörden vorgemacht. Inzwischen reichen über 80 Prozent der Deutschen ihre Steuererklärung via ELSTER ein. Was waren aus Ihrer Sicht hier die Erfolgsfaktoren und für welche andere Themen der Verwaltung ließe sich daraus lernen?
Das kann man als Erfolg bewerten, allerdings halte ich die Abstrahleffekte an dieser Stelle für eher gering. Zum einen gibt es ja eine verpflichtende Abgabe via ELSTER, zum anderen halte ich das Online-Frontend von ELSTER auch nicht für den Stein der Weisen in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit. Was allerdings sicherlich zum Erfolg der elektronischen Steuererklärung beigetragen hat, ist die Tatsache, dass ELSTER eine digitale Schnittstelle bietet – und dass es inzwischen ein Ökosystem aus anderen Softwareanbietern gibt, die relativ nutzerfreundliche Steuererklärungssoftware um diese Schnittstelle herum bauen und damit das Ausfüllen zuweilen drastisch vereinfachen.
Welche Potenziale haben KI-Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung?
KI und Algorithmen können den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr viel Arbeit abnehmen: bei der Vorbereitung von Entscheidungen oder des Schriftverkehrs, beim Abbau von Sprachbarrieren oder der Bereitstellung von Organisationswissen. Es wäre sicherlich eine Erleichterung, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einer Behörde kurzfristig relevante Informationen im Sprachdialog erhielte anstatt mühsam im Intranet danach zu suchen. Allerdings – und das ist ein ganz wichtiger Punkt – sehen wir solche Anwendungen abhängig vom Anwendungsfall häufig nur als Assistenzsysteme, bei denen am Ende immer noch ein Mensch eine Entscheidung trifft oder einen Vorgang auslöst.
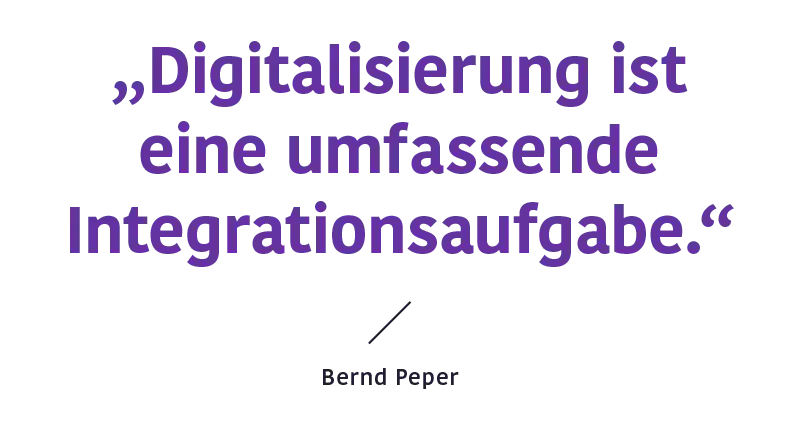
Sopra Steria berät nicht nur Behörden, sondern auch eine Vielzahl von Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Wirtschaftszweigen: Welches Zeugnis stellen Sie der Energiebranche aus in Bezug auf Digitalisierung?
Ein gemischtes: Seit 2016, mit dem „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“, hat der Energiesektor einiges erreicht. Denken wir zum Beispiel an die elektronische Rechnungsverarbeitung, den Einsatz standardisierter Cloud-Plattformen sowie an eine automatisierte Marktkommunikation aller Akteure. Dennoch bleibt die To-Do-Liste lang, wenn man sich allein das Thema Smart Metering anschaut: Statt weniger zentraler Kraftwerke müssen tausende dezentrale Erzeugungsanlagen gesteuert werden.
Ein Anbieterwechsel muss ab 2026 innerhalb von 24 Stunden möglich sein. Wärmeerzeugung und Mobilität werden in weiten Teilen mit Strom funktionieren. All diese Themen führen zu variableren Tarifen und einer komplexeren Steuerung. Dafür braucht es intelligente Messsysteme – und das flächendeckend. Das Tempo der Energiewende und das der Digitalisierung des Energiesektors hängen somit untrennbar zusammen.
Abschließend eine persönliche Frage: Von Kfz-Ummeldung über Personalausweis bis Anwohnerparken - welcher Vor-Ort-Ämterbesuch ist für Sie heute am unnötigsten?
„Unnötig“ ist ein sehr starkes Wort. Die von Ihnen erwähnten Besuche finden ja eher selten statt. Ganz grundsätzlich würde ich es aber begrüßen, wenn der Staat seine Bürgerinnen und Bürger - gerade in einschneidenden Lebenssituationen – etwas proaktiver und unkomplizierter unterstützen würde, anstatt sie mit Bürokratie zu überfordern. Es wäre doch beispielsweise schön, wenn bei der Geburt eines Kindes das Ausstellen einer Geburtsurkunde oder auch die Auszahlung des Kindergelds ohne großen Papierkram oder gar automatisiert, vonstattenginge. Gerade in existenziellen Lebensphasen hat man ja andere häufig ganz andere Dinge im Kopf als sich um Ämtergänge und Formulare zu kümmern.
Herr Peper, vielen Dank für das Gespräch.
Bernd Peper
ist Head of Public Sector bei der Unternehmensberatung Sopra Steria Next und Dozent bei der ThePower Business School.
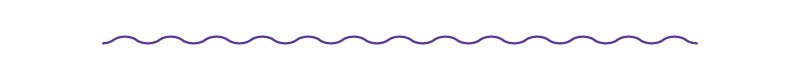
Mehr Interviews bei Zweitausend50
„Schuldenbremse passt nicht mehr ins Hier und Jetzt.“ – der Ökonom Jens Südekum plädiert für eine Anpassung der Schuldenbremse. Zum Interview
„Nur der Staat kann in Krisen Sicherheit bieten.“ – der DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert in Krisen staatliches Handeln – und benennt ein Tabu. Zum Interview
„Schon jetzt ein Bröckeln des Generationenvertrags.“ – der Soziologe Stefan Schulz über die Frage, wie der demographische Wandel unsere Zukunft gefährdet. Zum Interview
Zurück zur Magazin-Übersicht „Schnittstelle“



