Im Dezember 2021 wurde aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das BM für Wirtschaft und Klimaschutz. Klimaschutzmaßnahmen stehen allerdings auch im Ruf, die Wirtschaft zu bremsen statt sie voranzutreiben. Herr Giegold, wie sehen Sie das und wie stellen Sie sicher, dass aus der Schnittstelle keine Sollbruchstelle wird?
SVEN GIEGOLD: Also zunächst mal teile ich die Diagnose nicht, sondern es ist geradezu umgekehrt: Gerade weil wir uns in der Vergangenheit nicht genug um den Klimaschutz gekümmert und uns in eine fatale Abhängigkeit von fossilen Energiequellen mit dem Hauptlieferanten Russland gebracht haben, sind wir jetzt in einer Phase wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Wir hatten die Aufgabe, unter dieser geopolitisch so schwierigen Lage trotzdem Kurs zu halten und die Klimawende einzuleiten - und das haben wir geschafft.
 Sven Giegold
Sven Giegold
ist seit Dezember 2021 Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Zuvor war er Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis90/Die Grünen NRW, zuletzt Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, Obmann der grünen Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik und stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
Jetzt kommt es darauf an, dass die deutsche Wirtschaft und die deutsche Industrie von diesem Wandel auch ökonomisch profitieren. Dafür braucht es eine transformative Angebotspolitik, mit der wir den Standort Deutschland für die Unternehmen attraktiver machen. Und gleichzeitig brauchen wir Investitionssicherheit, was die Rahmenbedingungen in der Klima- und Energiepolitik angeht. Und ich weiß, dass sehr viele in der Wirtschaft das genauso sehen.
Zum Beispiel die Energiebranche?
KERSTIN ANDREAE: Die Energiebranche hat eine sehr hohe Gelingensbereitschaft, was das Thema Energiewende angeht, weil es um ihre künftigen Geschäftsmodelle geht. Wenn ein Land wie Deutschland sich entschieden hat, dass im Strombereich die Erneuerbaren im Zentrum stehen und dass es Moleküle und irgendwann einmal Wasserstoff als Partner gibt für die gesicherte Leistung - dann nehmen die Unternehmen das ernst und investieren in die Richtung. Man kann sehr klar erkennen, wie sich in den letzten zehn Jahren im Bereich der Energiewirtschaft der Dampfer da gedreht hat.
Unsere Sorgen sind natürlich Rahmenbedingungen und Planungssicherheit: dass man einerseits bei getroffenen Entscheidungen bleibt, dass andererseits aber auch konkrete Zielsetzungen mit Gesetzen hinterlegt werden müssen. Aktuell erleben wir noch eine Diskrepanz zwischen den Zielen auf der einen Seite und den Maßnahmen, die uns ermöglichen, diesen Zielerreichungspfad auch zu gehen. Kurz: Die Ziele stellt die Energiebranche nicht in Frage. Wir fordern aber einen verlässlichen Rahmen, der uns das auch ermöglicht.
Neue Geschäftsmodelle und Opportunitäten sind das eine, effizienter mit vorhandenen Ressourcen Wirtschaften das andere. Haben wir da schon alles ausgeschöpft?
PETER HENNICKE: Wir tun uns immer noch schwer, die Nachfrageseite von Ressourcen- und Energiemärkten in systemischer Betrachtung in die Energiewende einzubeziehen. Wir haben bei den Energiesparzielen eine nachgerade notorische Umsetzungslücke und andererseits ambitionierte Beschlüsse durch die COP 28 (Verdopplung der Rate der Energieffizienz bis 2030), aber auch durch die Europäische Union (Energieeffizienzrichtlinie). Wir müssen auch in Deutschland die jährliche Energieeffizienzsteigerung verdoppeln, kostengünstige Potenziale sind vorhanden.
 Prof. Dr. Peter Hennicke
Prof. Dr. Peter Hennicke
ist ein deutscher Ökonom und Hochschullehrer. Bis 31. Januar 2008 war er Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen. Er ist Mitautor des Buchs „Nachhaltige Mobilität für alle. Ein Plädoyer für mehr Verkehrsgerechtigkeit“
Wenn wir energieeffizienter werden, können wir die angestrebten 100 Prozent erneuerbare Energien schneller erreichen, die Umwelt- und Sozialverträglichkeit nimmt zu und zudem steigert dies auch gesamtwirtschaftliche Gewinne. „Energieeffizienz first“ ist nicht einfach ein Marketinglabel, sondern nach der EU ein maßgebliches Planungs- und Entscheidungskriterium im Energiesektor. Zur Umsetzung wünsche ich mir übrigens auch eine institutionelle Innovation, zum Beispiel in Form einer Bundeseffizienzagentur.
SVEN GIEGOLD: Wir haben bereits die dena als Effizienzagentur und ob uns die Gründung neuer paralleler Institutionen hier am meisten hilft, weiß ich nicht. Die Bundesregierung fördert Energieeffizienz auf vielfältige Weise. Und die wichtigste Förderung ist, dass wir im Bereich der Emissionszertifikate jetzt eine breite Abdeckung haben. Jedem ist klar, dass derjenige, der nicht in Effizienz investiert, in Zukunft wirtschaftliche Nachteile haben wird.
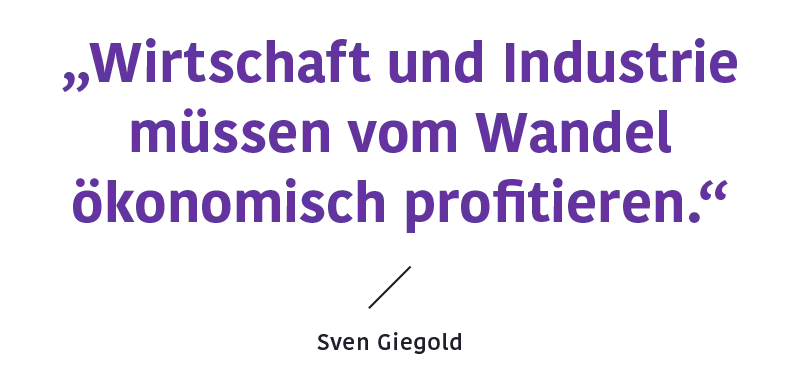
Aber eins ist auch wahr: Während in den Unternehmen schon sehr viel passiert, haben wir bei den Gebäuden nach wie vor einen deutlichen Rückstand. Und die bittere Wahrheit ist, dass man gegen die hohen Zinssätze der EZB nicht unbegrenzt ansubventionieren kann. Wir können die gestiegenen Kosten auf der Kapitalseite schlicht und einfach nicht ausgleichen mit begrenzten Haushaltsmitteln. Die Rahmenbedingungen dazu in dieser Bundesregierung sind ja bekannt.
KERSTIN ANDREAE: Ich denke, die enorme Bedeutung von Energieeffizienz ist richtigerweise benannt. Je effizienter wir Energie nutzen, umso besser. Für uns als Branche liegt da natürlich im Wesentlichen die Frage der Netzintegration dahinter. Wie kriegen wir smarte, intelligente Netze? Wie kann die Digitalisierung dabei helfen? Welche Regeln gibt es für Lastenabwurf? Was kann Sektorkopplung leisten?
Effizienz entsteht ja nicht nur durch geringeren Verbrauch allein, sondern auch durch smarte Infrastruktur, in der möglichst keine Kilowattstunde ungenutzt verlorengeht. Und was die Sektorenziele angeht, da sehen wir als Energiebranche schon sehr kritisch auf den Verkehrssektor, der unserer Ansicht nach zu viel entlastet wird. Auch der Agrarsektor übrigens.
PETER HENNICKE: Wir haben inzwischen eine gut angelaufene Stromwende. Auch im Vergleich zu anderen Industrieländern sind wir relativ erfolgreich – mit mehr als 50 Prozent fluktuierender Einspeisung aus Wind und Sonne. Wir haben den Atomausstieg als Meilenstein geschafft, der Kohleausstieg ist in greifbarer Nähe. Das sind gute und wichtige Etappensiege. Aber die wirklich großen Herausforderungen liegen noch vor uns, nämlich eine Gebäude- und Verkehrswende genauso erfolgreich und möglichst schnell voranzubringen.
Der Ablauf beim Gebäudeenergiegesetz war jedoch – es muss so deutlich gesagt werden - desaströs, das darf sich in der Form nicht wiederholen. Und das ist nicht allein die Schuld des BMWK, sondern von populistischen Angriffen auf die Energiewende. Wir brauchen eine gerechte sozialökologische Transformation. Und wir müssen durch soziale Flankierung vermeiden, dass wir ungerecht intervenieren in die Lebenswirklichkeit von Millionen von Haushalten.
KERSTIN ANDREAE: Ich stimme zu, dass der Gebäudesektor eigentlich die Königsdisziplin ist, wir sprechen immerhin über 40 Millionen Wohneinheiten. Aber eben auch über die Menschen, die darin wohnen oder Eigentümer sind. Daher kann ich das BMWK und die Regierung nicht ganz ungeschoren davonkommen lassen. Ich glaube, dass es ein Kardinalfehler war, dass das Gebäudeenergiegesetz nicht an der Infrastruktur angesetzt hat, sondern gleich am Haus.
 Kerstin Andreae
Kerstin Andreae
ist seit November 2019 Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW. Zuvor war sie wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und Initiatorin sowie Koordinatorin des Wirtschaftsbeirates der Fraktion.
Da stimmte die Reihenfolge einfach nicht. Der Fördertopf für den Heizungstausch war sicherlich richtig, aber: Warum haben wir uns nicht zuallererst die Infrastruktur angeschaut: Wie können überhaupt Wärmeenergieträgerund -technologien ins Haus kommen? Welche konkreten Optionen gibt es vor Ort? Wenn das geklärt ist, kann eine sachliche Entscheidung von Hauseigentümer, Mieter etc. getroffen werden im Hinblick auf die Frage, welche Heizung da eigentlich langfristig Sinn ergibt.
Mir ist bewusst, dass die politische und mediale Gemengelage alles andere als freundlich war, doch am Ende kam doch heraus: Gasheizungen und zum Teil sogar Ölheizungen haben gerade nochmal einen richtigen Boom erfahren. Ich hätte mich gefreut, wenn wir da gehört worden wären als Branche, weil wir da wirklich auch wieder in dieser Gelingenshaltung unterwegs sind. Da müssen jetzt noch viele unnötige Scherben eingesammelt werden.
SVEN GIEGOLD: Ich will gar nicht beschönigen, dass in der Ampelkoalition erhebliche Fehler gemacht worden sind. Sowohl in kommunikativer Hinsicht als auch bei der Frage, dass die Planung der Wärmewende ein gemeinsames gesellschaftliches und ökonomisches Projekt - und nicht eines von isolierten Gesetzen ist.
Dahinter steht aber folgendes Grundphänomen: Wir haben weder in Gesellschaft noch Politik einen Konsens über die Energie- und Klimapolitik in Deutschland. Wir sehen gerade wieder am Beispiel der Mobilitätswende, dass Teile des politischen Spektrums versuchen, eine radikale Gegenposition einzubringen.
Stichwort Mobilitätswende: Wie kann die gelingen und wo stehen wir hier aktuell in Deutschland?
PETER HENNICKE: Ich will zuerst das Vorurteil abräumen, dass die Verkehrswende nicht finanzierbar sei. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine brandneue Prognos-Agora-Studie, die sagt, dass eine rasche Verkehrswende ohne Einschränkung von Mobilität volkswirtschaftlich langfristig günstiger ist als der jetzige Referenzpfad. Wir könnten zudem jährlich über 28 Mrd.€ umweltschädlicher, verkehrsbezogener Subventionen einsparen. Es liegt also nicht an der Ökonomie, sondern es fehlt der politische Wille. Es geht darum, endlich ernst zu machen mit einer Verkehrswende.
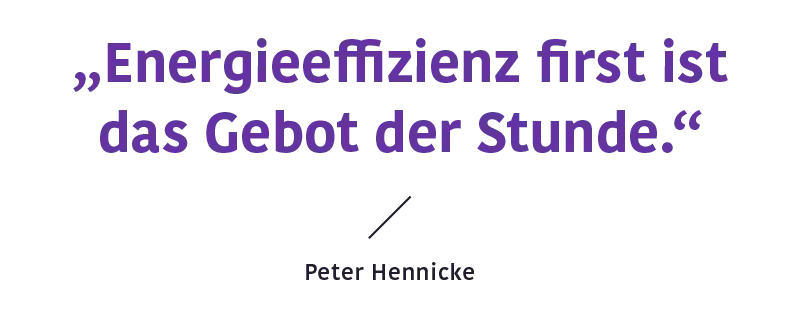
Das bedeutet, die Stadtplanung auf eine 15-Minuten-Stadt auszurichten, Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und auch mehr Verkehrsgerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Beispiele dafür gibt es in Hülle und Fülle in Europa. Ich denke an Barcelona mit verkehrsberuhigten Super-Blocks, an die Radwegeinfrastruktur in Dänemark und den Niederlanden, aber auch an Paris, wo sich die Champs-Élysées von einer sechsspurigen Straße in eine Flaniermeile verwandelt. Was wir brauchen ist eine Kommunikationsstrategie, die klar aufzeigt, dass die Verkehrswende die Lebensqualität für alle erhöht. Vor allem müssen wir auch auf dem Land eine gerechte Mobilität für jedermann ermöglichen.
SVEN GIEGOLD: Es ist richtig, dass die sektoralen Unterschiede bei der Erreichung der Klimaziele drastisch sind. Das, was die Energiebranche derzeit übererfüllt ist etwa so viel, wie der Verkehrsbereich aktuell verfehlt. Leider ist es aber so, dass es für eine umfassende Verkehrswende, wie Herr Hennicke sie fordert, in den Koalitionsverhandlungen keinen Konsens gab.
Was wir aber gemacht haben: Wir haben auf europäischer Ebene die notwendigen Veränderungen vorangetrieben und wir investieren endlich und massiv in den Bereich des öffentlichen Verkehrs. Es geht viel mehr Geld in die Bahn und den ÖPNV. Wesentlich mehr können wir gerade bei den derzeitigen Haushaltsbedingungen nicht machen.
KERSTIN ANDREAE: Danke für das Stichwort: Was ich nie verstanden habe, ist warum in diesem Koalitionsvertrag der Fokus nicht auf einer holistische Strategie für 15 Millionen E-Autos lag. Was ich für ein kluges Ziel, nämlich ein Klimaziel halte. Stattdessen gab es ein Ziel für eine Million Ladepunkte. Das ist glücklicherweise inzwischen kassiert worden, weil es das falsche Narrativ befördert, nämlich dieses: Solange es nicht genügend Ladepunkte gibt, ergibt der Kauf eines E-Autos keinen Sinn. Das ist aber totaler Unsinn, weil Laden und Tanken zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Außerdem fehlt mir aktuell sehr eine Positivkommunikation rund um die Elektromobilität, die täte dem Ganzen wirklich gut.
PETER HENNICKE: Ja und nein. Es geht nicht nur um das Antriebskonzept oder den Energieträger. Unsere Autoflotte fährt heute durchschnittlich mit 165 PS. 1973 hatten wir einmal 60 PS – und das hat völlig ausgereicht. Was wir also wirklich brauchen, ist ein Anreiz zum Downsizing und zur Reduzierung unserer Autoflotte. Wir müssen weg von 40 Prozent SUVs bei Neuzulassungen. Wir brauchen Autos, die in einen zeitgemäßen systemischen Umweltverbund passen, in ein Konzept mit Verkehrsvermeidung und gleichzeitigem Zugang für alle.
Während auf der einen Seite die Autos für die Mehrheit immer größer und leistungsstärker werden, gibt es auf der anderen Seite einen beträchtlichen Anteil der Bevölkerung, die überhaupt keinen Zugang zum Auto oder Mobilitätsalternativen hat. Das muss sich ändern, sonst kriegen wir keine Unterstützung für eine nachhaltige Mobilitätswende - und es bleibt alles, wie es ist.
SVEN GIEGOLD: Dieses Gesamtkonzept zur Energie – und zur Verkehrswende, welches Sie beide fordern, das würde ich mir auch wünschen. Ziel muss es sein, und darauf soll beispielsweise das Mobilitätsdatengesetz einzahlen, dass wir eines Tages online und am Schalter ein Ticket kaufen können, das uns in ganz Europa barrierelos von Haustür zu Haustür reisen lässt.
Es sind schon viele innovative Unternehmen in den Startlöchern, die nur auf diese Daten warten, und da werden wir den Weg freimachen. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass ein erheblicher Teil der Verantwortung für das Thema Mobilität einerseits beim federführenden Ressort liegt – und dass hier andererseits alle Ressorts intensiv zusammenarbeiten müssen.
KERSTIN ANDREAE: Mir ist klar, dass das eine Herkulesaufgabe ist. Ich denke immer öfter, dass die Politik allein – und das ist kein Vorwurf – gar nicht mehr in der Lage ist, solche großen komplexen Zusammenhänge zügig und zugleich in der Tiefe zu bearbeiten. Ich glaube auch, dass es mehr qualitativ starke Zusammenarbeit der Stakeholder zwischen Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Institutionen und NGOs geben muss.
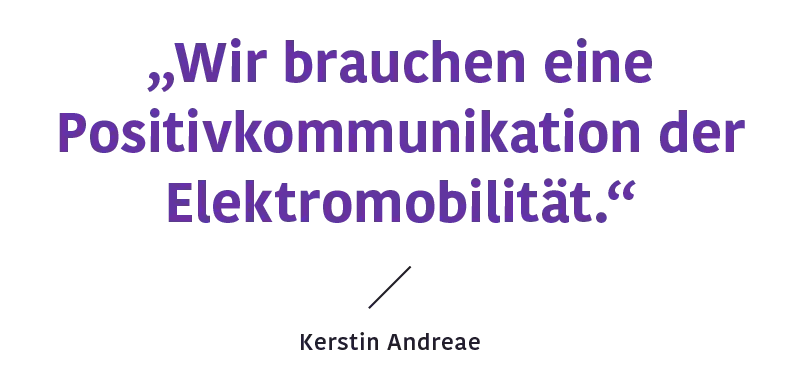
Ich sehe da auch durchaus die Wirtschaft in der Pflicht, bei solchen Gesprächen, bei solchen Stakeholder-Ansätzen einen höheren Konnex her zu bekommen zwischen den verschiedenen Wertschöpfungsstufen – und nehme aus diesem Gespräch mit, dass wir uns beim BDEW hierzu einmal konkrete Gedanken machen wollen, wie wir da konkret unterstützen können.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf unser Schwerpunktthema Schnittstellen. Gibt es vielleicht auch Konzepte, Ideen, Technologien, bei denen wir einen Schnitt machen, von denen wir uns verabschieden müssen, damit die Energiewende gelingt?
SVEN GIEGOLD: Aus meiner Sicht müssen wir uns von der Logik des Verabschiedens verabschieden. Diese Lektion hat die Umweltbewegung gelernt: Alle Kampagnen, die versucht haben, Menschen dazu zu bringen, "lass dies, lass das, tu dieses nicht", waren intellektuell zwar richtig, politisch am Ende aber wenig erfolgreich. Gerade wenn wir wissen, dass wir Grenzen durchsetzen wollen, dann muss dies als Freiheitsgewinn für die Menschen ankommen. Ich halte das für möglich. Ich glaube, dass man besser leben kann mit weniger materiellem Durchsatz. Und das ist die Botschaft, die wir über alle Wege hinweg verbreiten müssen.
PETER HENNICKE: Da kann ich nur mit vollem Herzen zustimmen. Ich würde gerne noch eines ergänzen: Wir haben aktuell gewaltige Finanzierungsaufgaben, durch eine Klima-, eine Ressourcen-, eine Verteilungs- und eine Friedenskrise. Der Kreditbedarf ist unabweislich. Ich halte es daher für außerordentlich rückständig, an einer antiquierten Schuldenbremse festzuhalten. Das sagt die überwiegende Mehrheit der Experten weltweit und auch in Deutschland. Wenn wir Freiheitsrechte wirklich ernst nehmen, insbesondere auch für zukünftige Generationen und für Menschen im globalen Süden, dann brauchen wir jetzt ein großes kreditfinanziertes öffentliches Zukunftsinvestitionsprogramm.
KERSTIN ANDREAE: Wir sollten immer vor Augen haben, dass für viele Menschen das Ende des Monats viel näher als das Ende der Welt ist. Die Frage, dass die Verteuerung der Fossilen einhergehen muss mit Angeboten, die bezahlbar sind, ist vermutlich die entscheidende für die Akzeptanzfrage. Und zur Frage, wovon wir uns verabschieden sollten: Ich wäre nicht traurig, wenn es in absehbarer Zeit keine motorbetriebenen Laubbläser mehr gäbe (lacht).
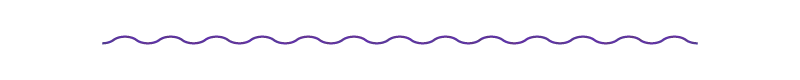
Mehr Round-Table-Gespräche
„Ist der Kapitalismus noch zu retten?“ – Staatliche Eingriffe oder freies Spiel der Marktkräfte? Kerstin Andreae im Gespräch mit Ulrike Herrmann, Lion Hirth und Klaus Müller. Zum Gespräch
„Wir brauchen eine langfristig angelegte Politik“ – Die Ukraine-Krise befeuert die Energiewende. Kerstin Andreae im Gespräch mit Prof. Dr. Veronika Grimm und Dr. Katrin Suder. Zum Gespräch
„Handeln, bevor es zu spät ist“ – Die globale Klimapolitik nach der US-Wahl. Kerstin Andreae im Gespräch mit Dr. Susanne Dröge (SWP) und Dr. Christian Hübner (KAS). Zum Gespräch
Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Schnittstelle“



