Immer wieder gab es in der Geschichte der Mobilität Innovationen und Produkte, die ihrer Zeit voraus waren. Für manche war die Welt noch nicht bereit, sie verschwanden in der Versenkung und kamen erst später wieder hervor; andere sind bis heute im Einsatz. Wir blicken auf fünf Beispiele mit Strahlkraft.
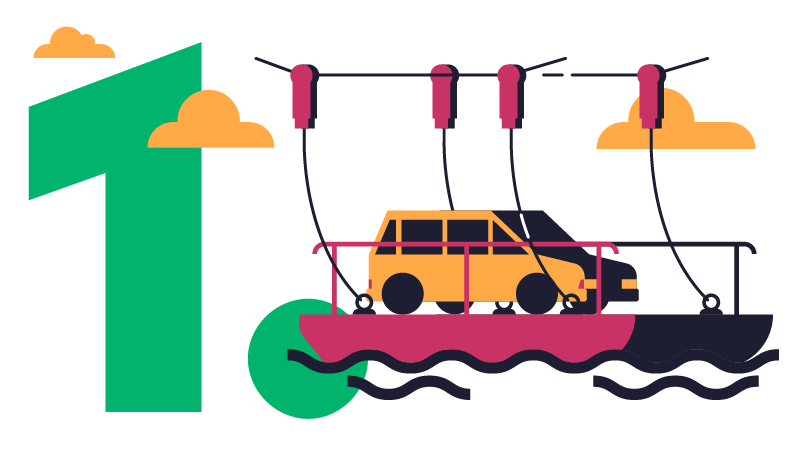 Alles im Fluss – die Gierseilfähre
Alles im Fluss – die Gierseilfähre
Bereits 1657 ersann der niederländische Ingenieur Hendrick Heuck aus Nijmegen eine neuartige Fähre, mit der ein Fluss komplett ohne Treibstoffe oder Motoren überquert werden kann. Stattdessen wird die Strömungsenergie des Flusses für den Vortrieb ausgenutzt. Die Gierseilfähre hängt über die Längsachse an einem langen Drahtseil, das an beiden Ufern verankert ist. Das Seil teilt sich kurz vor dem Bug in zwei Stränge auf, die am Heck wieder zusammenlaufen. Um die Fähre in Bewegung zu setzen, werden an Bord die Längenverhältnisse der bug- und heckseitigen Kabelenden zueinander verändert. Dadurch verändert sich auch der Anstellwinkel der Fähre zum Strom. Der Druck des Wasserstroms drängt die Fähre seit- und zugleich vorwärts. Gierseilfähren sind bis heute überall auf der Welt im Einsatz. Übrigens, bei manchen Gierseilfähren wird ein wenig „geschummelt“: Hier übernehmen Elektromotoren das Verändern des Anstellwinkels beim Ablegen und Anlanden. Da diese jedoch immer nur kurz benötigt werden, können Photovoltaikanlagen in Verbindung mit Speicherbatterien für einen CO2-neutralen Betrieb sorgen.
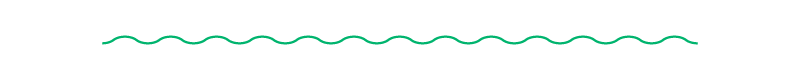
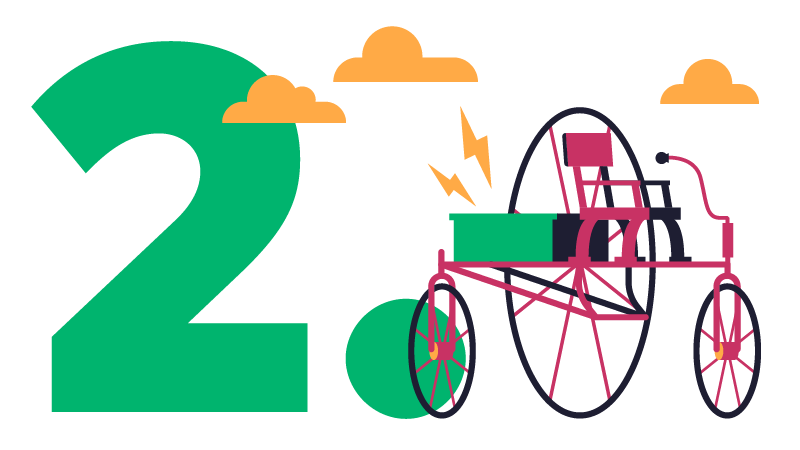 Elektromobilität: Ein alter Hut
Elektromobilität: Ein alter Hut
Wer glaubt, dass Elektroautos eine Erfindung der Neuzeit sind, der irrt. Schon 1881 stellte der französische Erfinder Gustave Trouvé das erste elektrisch betriebene Kraftfahrzeug vor. Es handelte sich dabei um ein Dreirad, das mit einem Elektromotor angetrieben wurde und mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet war. Trouvés Fahrzeug bestand aus einem ursprünglich mechanischen Dreirad der Marke Starley Coventry Lever und einem von Trouvé modifizierten Siemens-Antriebsmotor, der unterhalb der Antriebsachse eingebaut war. Der Motor trieb das linke große Rad über eine Hakenkette an, gelenkt wurde über die beiden gegenüberliegenden kleineren Räder. Ein handelsüblicher 12-Volt-Bleiakkumulator diente als Energiespeicher. Aufgrund der asymmetrischen Verteilung großer und kleiner Räder dürfte das Fahrzeug im Betrieb eine leichte Unwucht gehabt haben, auch die Leistungswerte lesen sich aus heutiger Sicht wenig beeindruckend: Die Maximalgeschwindigkeit betrug zwölf Stundenkilometer, der Motor leistete ein Äquivalent von 0,1 Pferdestärken – und die durchschnittliche Reichweite mit einer Akkuladung beschränkte sich auf 20 Kilometer.
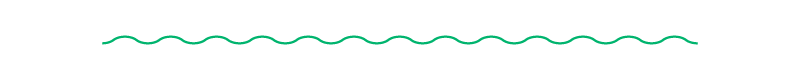
Bildergalerie: Ihrer Zeit voraus
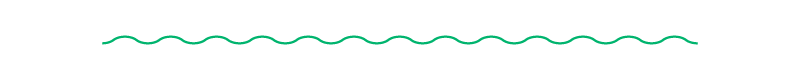
 Der „fliegende Hamburger“
Der „fliegende Hamburger“
Selige Zeiten: Schon im Jahr 1933 konnte man in lediglich 138 Minuten von Berlin nach Hamburg reisen, und zwar ohne Zwischenhalt oder umgekehrte Wagenreihung. Möglich machte das der „Fliegende Hamburger“, vom Görlitzer Hersteller WUMAG etwas prosaischer „Schnellverbrennungstriebwagen 877“ genannt. Der Fliegende Hamburger erreichte trotz seines stattlichen Gewichts von 85 Tonnen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern und machte damit seinerzeit weltweit die schnellste Passagierzugverbindung möglich. Angetrieben wurde der Fliegende Hamburger von zwei Zwölfzylinder-Viertakt-Dieselmotoren aus dem Hause Maybach. Vom 15. Mai 1933 an verkehrte der Zug planmäßig zwischen dem Lehrter Bahnhof in Berlin und dem Hamburger Hauptbahnhof. Erst 64 Jahre später, nämlich im Juni 1997, konnte ein ICE der Deutschen Bahn den Geschwindigkeitsrekord des Fliegenden Hamburger unterbieten, allerdings lediglich um sechs Minuten.
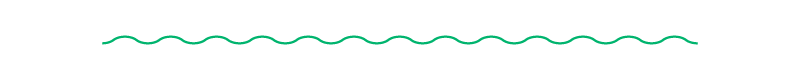
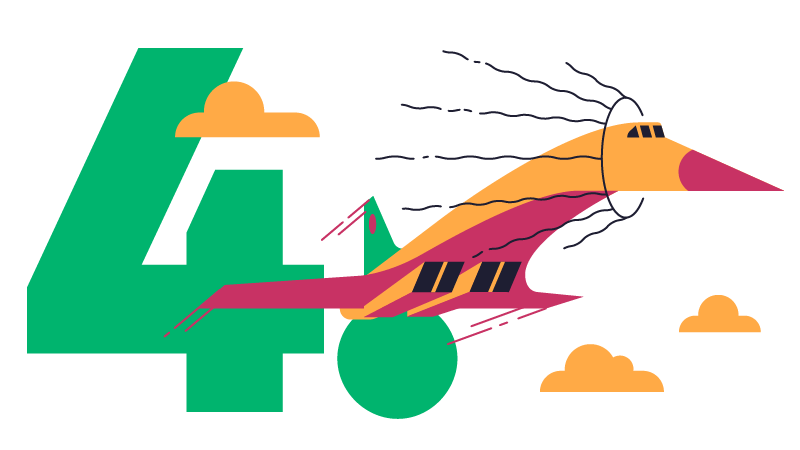 Schneller als der Schall – aber NICHT die Concorde
Schneller als der Schall – aber NICHT die Concorde
Wer hätte es gedacht: Das erste Passagierflugzeug, das bei horizontaler Flugbahn (also nicht im experimentellen Steilflug) schneller als der Schall flog, war nicht die Concorde, sondern die sowjetische Tupolew Tu-144. Entwickelt wurde sie vom Flugzeugkonstrukteur Alexei Andrejewitsch Tupolew. Die Tu-144 absolvierte ihren Erstflug 1968 nach sechsjähriger Entwicklungszeit und wurde 1975 in den Dienst als Verkehrsflugzeug gestellt. Die Reisegeschwindigkeit betrug rund 2.470 km/h, was der doppelten Schallgeschwindigkeit entspricht. Ein Flugticket für die Tu-144 kostete seinerzeit 82 Rubel, etwa die Hälfte eines durchschnittlichen sowjetischen Monatseinkommens. Bei der Concorde hingegen mussten Passagiere deutlich tiefer in die Tasche greifen: Inflationsbereinigt betrug der Ticketpreis für einen Rückflug Paris/New York zwischen 4.500 und 11.000 Euro – dafür gab’s aber auch eine standesgemäße Bordverpflegung mit Hummer, Kaviar und Champagner.
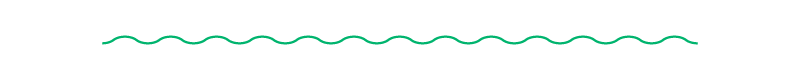
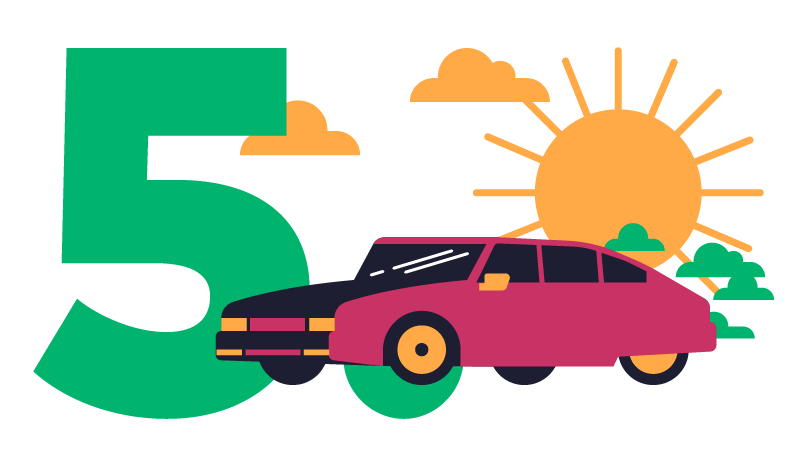 „Flache Flunder“
„Flache Flunder“
Am 26. August 1974 wurde der Citroën CX erstmals anlässlich des Automobilsalons in Paris präsentiert. Er gilt als Synthese aller technischen Entwicklungen von Citroën. Schon damals konnte er mit einem sensationell niedrigen Cw-Wert von 0,39 punkten. Legendär war die hydropneumatische Federung, die den Wagen wie auf einem Luftkissen gleiten ließ – und die es möglich machte, mit einem zwischen den Vordersitzen befindlichen Hebel das Fahrzeugniveau anzuheben oder abzusenken. Ebenfalls hydraulisch betrieben war die Servolenkung, die auf den Namen „Diravi“ hörte (DIrection assistée à RAppel asserVI, zu deutsch etwa „unterstützte Lenkung mit abhängiger Rückführung“) und selbst im Stand das Lenkrad nach einem Links- oder Rechtseinschlag selbstständig zurückführte. Angenehmer Nebeneffekt der besonderen Konstruktion: Selbst bei einer scharfen Vollbremsung blieb der CX immer sicher in der Spur, ganz ohne Antiblockiersystem. Ebenso gewöhnungsbedürftig wie visionär war auch das Cockpit – mit vollmondgelb beleuchtetem Walzen- und Lupentacho und einer Vielzahl bunter Anzeigeinstrumente und Kontrolleuchten.
Mehr zu neuen Ideen
"Erfolgreiche Zusammenarbeit braucht gemeinsame Ziele" – Volker Lazzaro über politische Notwendigkeiten, Kooperationen und Überraschungen beim Ausbau der Elektromobilität. Zum Interview
Kommunizierende Röhren – Eine Jahrzehnte alte Infrastruktur als Dreh- und Angelpunkt der Energiewende? Die europäischen Gasnetze können mehr, als man denkt. Zum Feature
„Mehr Effizienz und neue Geschäftsmodelle“ – Big Data und Künstliche Intelligenz: Turbolader für die Energiebranche? Im Gespräch mit Philipp Richard von der dena. Mehr erfahren
Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Mobilität“







