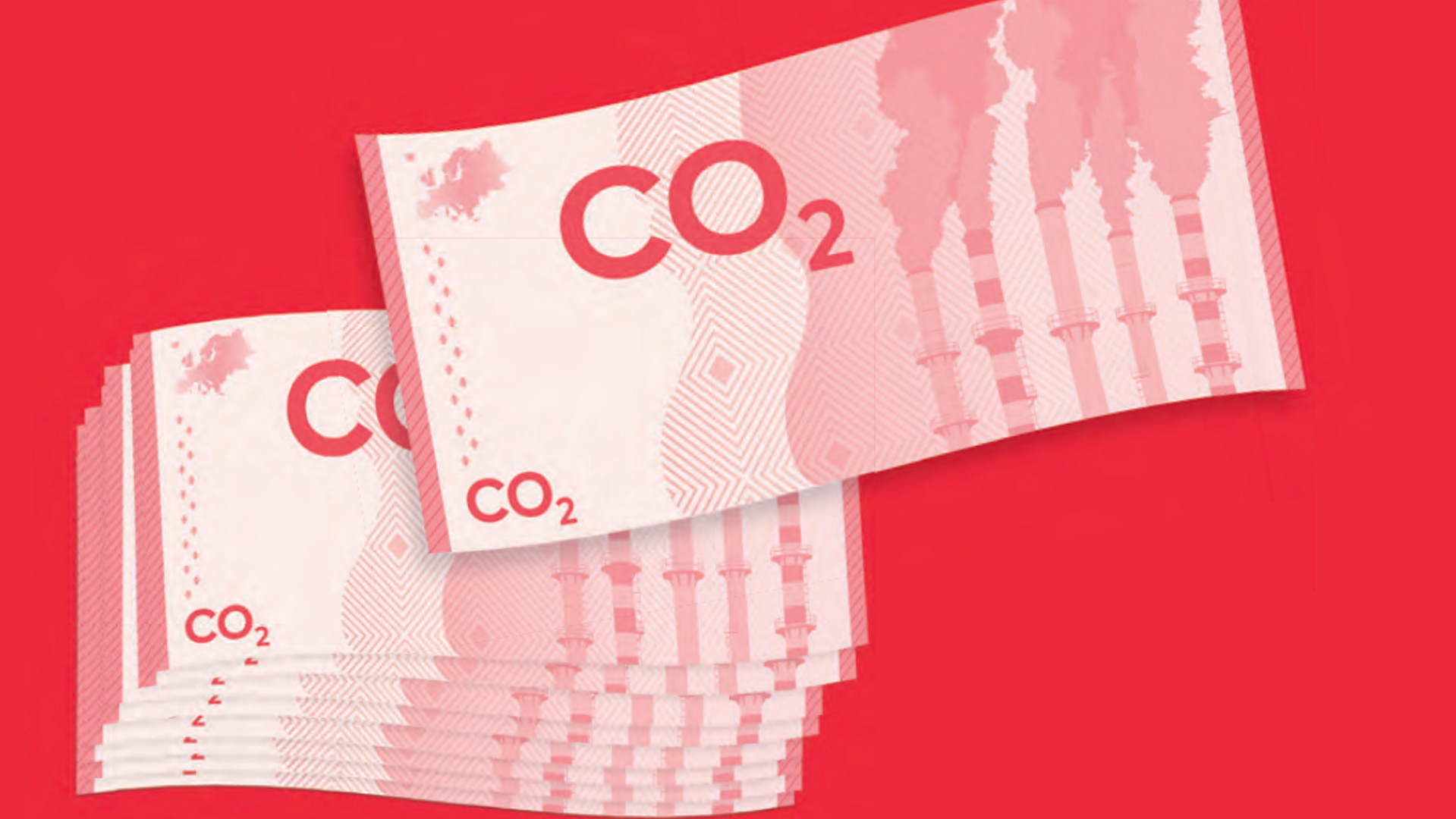Seit das Bundeskabinett im Herbst 2019 sein Klimaschutzprogramm 2030 verabschiedete, wird in Deutschland vermehrt über den Preis für CO2-Emissionen diskutiert. Die in dem Programm formulierten Zusatzabgaben auf das Treibhausgas seien zu niedrig, um eine Lenkungswirkung zu erzielen, sagen manche. Andere sehen ihre Region durch die Kosten benachteiligt – zum Beispiel in der Lausitz. Deutschland führt eine nationale CO2-Bepreisung vergleichsweise spät ein. Schon seit Anfang der 1990er-Jahre gelten in anderen Ländern Europas entsprechende Regelungen. Einige wurden zusätzlich zum Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU-EHS) installiert. Andere funktionieren unabhängig. Wie handhaben die einzelnen Länder die Abgabe auf CO2? Welche Erfahrungen gibt es? Jedes Land hat eigene Voraussetzungen. Das zeigen die Beispiele in Frankreich, Großbritannien und der Schweiz.
Dass eine CO2-Bepreisung effektiv sein kann, sieht man in der Schweiz. Das Bundeshaus in Bern führte im Jahr 2008 eine CO2-Abgabe auf Heizöl und Erdgas ein, umgerechnet acht Euro kostete den Verbraucher eine Tonne CO2. Bis 2018 stieg die Abgabe auf 85 Euro. Die Emissionen im Gebäudesektor sanken im selben Zeitraum um 20 Prozent, so eine Studie des Berliner Mercator Research Institutes. Die Schweiz gilt als Musterbeispiel für eine gelungene CO2-Bepreisung. Die Abgabe ist jedoch keine Steuer, die in den Staatshaushalt fließt, sondern eine Umlage. Mit einem Drittel der Einnahmen fördern Bund und Kantone energetische Sanierungen von Gebäuden. Zwei Drittel der Einnahmen werden direkt an die Bevölkerung zurückverteilt – gleichmäßig an alle in der Schweiz wohnhaften Personen.

Die CO2-Abgabe ist allgemein akzeptiert, für den Klimaschutz gibt es einen starken Konsens. Das hat konkrete Gründe: Bei der CO2-Bepreisung gehe es auch um Gerechtigkeit, sagt Dr. Constanze Haug, Senior-Projektmanagerin in den Bereichen Klima und Energie bei dem Berliner Forschungs- und Beratungsinstitut adelphi. "Zentral ist die Frage, wie der Staat mit den zusätzlichen Einnahmen umgeht. Werden sie zumindest teilweise transparent zurückerstattet? Werden Härtefälle abgefedert?"
Monatelang landesweite Proteste
In Frankreich gab es ab Ende 2018 monatelang Proteste und Krawalle der "Gelbwesten". Anlass war die Erhöhung der Mineralölsteuer um sieben Cent pro Liter Diesel und drei Cent pro Liter Benzin. Es war eine turnusmäßige Steigerung der CO2-Abgabe zum Jahreswechsel 2018/19. Präsident Emmanuel Macron setzte sie angesichts der heftigen Reaktionen aus. Dennoch gingen die Demonstrationen weiter. Die Denkfabrik Agora Energiewende kam in einer Analyse zu dem Schluss, dass sich die Proteste überwiegend nicht gegen den Klimaschutz richteten, sondern gegen die soziale Umverteilung, die der CO2-Beitrag verstärkte. So habe die französische Regierung gleichzeitig die Tabaksteuer und die pauschalen Sozialbeiträge erhöht und die Wohngeldzuschüsse gesenkt. "All das belastet Haushalte mit geringem Einkommen viel stärker als diejenigen mit mittlerem Einkommen", so Murielle Gagnebin, eine der Autorinnen der Agora-Analyse.
Zentral ist die Frage, wie der Staat mit den zusätzlichen Einnahmen umgeht
Dabei war die Einführung der CO2-Abgabe in Frankreich im Jahr 2014 unspektakulär verlaufen. Sie wurde den üblichen Energieverbrauchssteuern auf Erdgas, Kohle und Heizöl als "Beitrag für Klima und Energie" hinzugefügt und betrug sieben Euro. Zunächst sei die Steuer "unter dem Radar" der Öffentlichkeit geblieben, sagt Haug. Doch dann sei die Bepreisung steil angestiegen – und damit die Aufmerksamkeit.
Mittlerweile beträgt die CO2-Abgabe in Frankreich 44,60 Euro pro Tonne CO2. Mit den Einnahmen fördert die Regierung den Ausbau Erneuerbarer Energien. Darüber hinaus unterstützt sie Haushalte bei energiewirtschaftlichen Investitionen und zahlt Prämien für emissionsarme Autos. Doch der Umfang der finanziellen Rückführungen an die Bürger ist in Frankreich nicht vergleichbar mit dem in der Schweiz.

Auch in Großbritannien gibt es eine CO2-Abgabe. Diese fließt nicht zurück zum Endverbraucher. Privathaushalte zahlen sie aber auch nicht – zumindest nicht direkt: Der CO2-Ausstoß wird in Großbritannien Unternehmen und Großabnehmern in Rechnung gestellt. Über die Preise ihrer Produkte beteiligen sie auch Privathaushalte. Zunächst gibt es die Klimawandelabgabe, die seit 2001 auf den Verbrauch von Erdgas, Stein- und Braunkohle, Flüssiggas sowie Elektrizität erhoben wird. Der Verbrauch dieser fossilen Energieträger zur Stromerzeugung war davon jedoch befreit. Seit 2013 gibt es zusätzlich zur Klimawandelabgabe einen Mindestpreis auf den Zertifikate-Handel der EU – den "Carbon Price Floor".
Dieser Mindestpreis wird auf die Stromerzeugung mit Kohle, Erd- und Flüssiggas sowie Öl angewandt. Er lag bislang immer über dem Preis des EU-EHS-Zertifikats. Stromproduzenten müssen beim Kauf der Energieträger die Differenz zwischen Mindestpreis und dem Preis des entsprechenden EU-EHS-Zertifikats an das britische Finanzamt entrichten. Die Einnahmen fließen in den Gesamthaushalt und sind nicht zweckgebunden. Im Jahr 2017 nahm das Finanzministerium damit rund 1,2 Milliarden Euro zusätzlich ein, heißt es in einer Studie der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch aus Bonn. Der Mindestpreis habe in Großbritannien "einen erheblichen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen geleistet". Der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung sei von 41 Prozent im Jahr 2013 auf weniger als acht Prozent im Juli 2017 gesunken.
Mindestpreis auf das EU-EHS
Die britische Regierung kam mit dem "Carbon Price Floor" einem Gesetz von 2008 nach, in dem sie sich verpflichtet hatte, die Wirtschaft kontinuierlich zu dekarbonisieren. Die zusätzliche Bepreisung basiert auf der Einschätzung, dass die Wirkung des EU-EHS dafür nicht ausreiche. 18 Pfund (rund 21 Euro) kostet die Emission von einer Tonne CO2 mittlerweile, rechnet man den EU-EHS und nationalen Mindestpreis zusammen.
"Es gibt einen sehr breiten gesellschaftlichen Konsens für ein sehr ambitioniertes Handeln im Klimaschutz", sagt Haug. Dieser Konsens reiche bis ins Parlament. Zuletzt hatte das Unterhaus im Mai 2019 ein Gesetz verabschiedet, das Großbritannien dazu verpflichtet, seine klimaschädlichen Emissionen bis 2050 auf null zu senken. In einer Rede verwies Energie-Staatssekretär Chris Skidmore auf die Verantwortung seines Landes, in dem die industrielle Revolution begonnen habe. Sie habe zu Wirtschaftswachstum geführt – aber auch zum Anstieg der Treibhausgase. Das verpflichte nun zu einer Vorreiterrolle im Klimaschutz.

Aber auch die Wirtschaft zieht mit. Das werde bei Gesprächen in Großbritannien schnell klar, schrieben Brick Medak und Alexander Reitzenstein vom internationalen Klimaschutz-Thinktank E3G im Mai 2019 in einem Gastbeitrag auf dem Fachportal energate messenger. Die Politik bemühe sich darum, der Real- und Finanzwirtschaft klare Signale zu senden und Planungssicherheit zu bieten. Das fördere Investitionen "in klimafreundliche, zunehmend günstige Technologien und Innovationen in besonders herausfordernden Bereichen wie Schwertransport, Landwirtschaft oder Industrieprozessen".
Bürgerversammlung für mehr Klimaschutz
In Frankreich haben sich die Proteste der Gelbwesten wieder gelegt. Seit Oktober 2019 tagt eine von der Regierung einberufene Bürgerversammlung. Sie setzt sich aus 150 Mitgliedern zusammen, die nach demographischen Kriterien aus allen gesellschaftlichen Schichten ausgewählt wurden. Sie sollen nun Vorschläge für mehr Klimaschutz machen. Vorausgegangen waren regionale Veranstaltungen mit mehreren tausend Bürgern. Das sei "ein recht innovativer Prozess", sagt Haug. "Es ist spannend, was dabei herauskommt."
Text: Günter Marks
Mehr erfahren zum CO2-Preis
"Zentrales Instrument der Klimapolitik" - das empfiehlt der Sachverständigenrat der Bundesregierung. ZUM GUTACHTEN